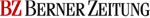- Region
Stadt Bern: "Wir sind die Letzten"
Schwester Erika (79) gehört zu den letzten 32 Diakonissen, die in der Stadt leben. Die Tradition wird sterben, aber Erika schliesst nicht aus, dass ihr verzichtsreicher, gemeinschaftlicher Lebensstil trotzdem eine Zukunft hat.
Schwester Erika, wie wurden Sie Diakonisse?
Wir hatten eine Diakonisse in der Verwandtschaft, aber ich selber hatte nie den Gedanken, das ebenfalls zu werden. Ich wollte heiraten und Familie und Kinder haben. Als ich im Spital Huttwil auf der Wöchnerinnenabteilung arbeitete, merkte ich, dass es auch nicht immer rundläuft, wenn man Familie hat. Dann traf mich plötzlich die Berufung.
Wie fühlte sich das an?
Es war in einer Zeit, als es mir bei der Arbeit nicht so gut ging. Da spürte ich, jetzt ruft mich Gott in den Dienst. Er soll bestimmen, was ich mache, und nicht mehr nur ich selber. Es braucht diese Berufung. Begeisterung reicht nicht, um Diakonisse zu werden.
Wie alt waren Sie da?
Ich war über 20 Jahre, und das war gut so. Wir hatten früher mehr Schwestern, die direkt vom Konfirmandenunterricht in die Diakonie kamen. Ich finde, man muss schon ein wenig Lebenserfahrung mitbringen.
Wie reagierten Ihre Eltern und Freunde?
Für die Eltern war es schwierig. Sie stellten sich vor, dass ich heirate und dann vielleicht mit meiner Familie unseren kleinen Hof in Mirchel übernehme. Es gab aber auch Freunde, die sich freuten über meinen Entscheid. Andere sagten mir, sie hätten jemanden gehabt, den ich hätte heiraten können. Für mich war aber klar: Das ist nicht mein Weg. Meine Eltern haben meine Entscheidung dann akzeptiert.
Hätte es für Sie einen Weg zurück gegeben?
Ja. Die ersten drei Monate in der Schwesterngemeinschaft sind Vorprobezeit, danach folgen fünf Jahre, nach denen man sich zur Einsegnung melden kann. Man gibt ein Versprechen ab, aber kein Gelübde. Es kam vor, dass jemand realisierte, das ist doch nicht der Weg. Es gab immer wieder Austritte.
Sie zweifelten nie?
Doch, natürlich. Ich hatte Zweifel und auch Zeiten, in denen es mir nicht so gut ging. Aber ich sagte mir stets: Gott hat mich gerufen, und wenn er mich nicht wieder hinausführt, bleibe ich dabei.
Wie leben Sie im Mutterhaus der Diakonissen?
Ich habe mein eigenes Zimmer, alle anderen Räume sind gemeinschaftlich, auch WC und Dusche. Am Morgen um 7.15 Uhr findet eine gemeinsame liturgische Andacht statt. Meistens besuche ich sie. Wenn man später aufsteht, ist ja der Tag schon halb gelaufen. Um 8.30 Uhr gibt es eine weitere Andacht, die ich meist am Radio höre. Um 11.15 Uhr folgt das Mittagslob, dann das Mittagessen. Am Nachmittag habe ich Zeit für mich, um 17.30 Uhr essen wir zu Abend. Oft besuche ich die älteren Schwestern im Heim Oranienburg hier an der Schänzlistrasse.
Ferien machen Sie auch?
Natürlich, es gibt Schwestern, die leidenschaftlich reisen. Ich war kürzlich im Goms in den Ferien, wunderbar. Die Diakonissen-Tracht liess ich zu Hause, sie ist bei kalten Temperaturen nicht so praktisch. Und wenn ich mit den Stöcken wandere, sähe ich in ihr ziemlich komisch aus.
Haben Sie ein Smartphone?
Ich habe ein Handy, das ich ab und zu zum Telefonieren brauche und vor allem, um SMS zu verschicken. Ein guter Draht zu jungen Leuten und ihren Ideen ist mir wichtig. Technischen Neuerungen verschliessen wir uns nicht. Es ist normal, dass die Schwestern mit iPhone und über Whatsapp kommunizieren. So schön es ist, mit der ganzen Welt verbunden zu sein, es schafft auch neue Probleme.
Wie stehts um den Nachwuchs?
Wir sind noch 32 Diakonissen, keine ist mehr unter 65-jährig. Es gab ab und zu noch Anfragen für Neueintritte, aber meistens waren es Leute mit psychischen Problemen. Wir haben selber entschieden, niemanden mehr aufzunehmen. Eine junge Frau bei all diesen Grossmüttern, das wäre nicht gut herausgekommen.
Ein Leben wie Ihres wird es nicht mehr geben.
Wir sind die Letzten.
Beschäftigt Sie das?
Den Wandel kann man nicht aufhalten. Wir haben uns vor allem in der Alters-, Kranken- und Palliativpflege engagiert, die Arbeit von uns Schwestern für die Stiftung machen nun Angestellte. Es gibt viele Vorschriften, man ist nun eingebunden ins System. Oft bleibt die Zeit für die Menschen, die man pflegt, auf der Strecke. Dem zuschauen zu müssen, das schmerzt mich manchmal.
Wie sehen Sie die Zukunft?
Mein Wunsch ist es, dass die Stiftung bei den christlichen Wurzeln bleibt. Ich schliesse nicht aus, dass das Bedürfnis, ein Leben zu führen wie ich, wieder wächst. Dass man es wichtig findet, nicht alles der geschäftlichen Logik unterzuordnen.
175 Jahre Stiftung Diaconis
Diakonissen, die man als reformiertes Pendant zu den katholischen Nonnen bezeichnen könnte, gehörten mit ihrer blauen Tracht und der weissen Haube noch vor wenigen Jahrzehnten zum Berner Stadtbild. Stadtpräsident Alec von Graffenried jedenfalls hat dieses Bild in seiner Erinnerung, wie er gestern am Sitz der Diakonissen an der Schänzlistrasse über dem Altenberg festhielt. Auch darum, weil von Graffenrieds Mutter wegen ihrer Krebserkrankung monatelang im damals von Diakonissen geführten Salemspital lag und dort auch starb. Sie und ihre Familie seien von den Schwestern sehr warm und fürsorglich betreut worden, sagte er.
Das Salemspital gehört seit 2002 der Hirslanden-Gruppe, das Diakonissenhaus heisst seit 2011 Stiftung Diaconis und wird präsidiert von Hans Zoss, dem früheren Direktor der Strafanstalt Thorberg. Diaconis betreibt in Bern drei Altersheime, eine Seniorenresidenz und beschäftigt 330 Mitarbeitende. 175 Jahre nach der Gründung leben noch 32 Schwestern, alle im Ruhestand. Der Lebensentwurf der Diakonissen, im Dienst an Mitmenschen aufzugehen, sei ein «aussterbendes Modell», sagt Stiftungsdirektor Peter Friedli. Der Grundgedanke habe aber Zukunft: mit Pioniergeist sozial Benachteiligten beizustehen. In den 90er-Jahren lancierten die Diakonissen in Bern als Erste ein Reintegrationsprojekt für Stellenlose und ein Haus für Palliativpflege. Für letztere will Diaconis nun neue Finanzierungsmodelle testen.
Der Stadt schenkt Diaconis zum Jubiläum sechs Sitzbänke sowie öffentliche Veranstaltungen. Infos unter www.diaconis.ch. (jsz)
Erstellt:
18.01.2019
Geändert: 18.01.2019
Klicks heute:
Klicks total:
Bei BERN-OST gibt es weder Bezahlschranken noch Login-Pflicht - vor allem wegen der Trägerschaft durch die Genossenschaft EvK. Falls Sie uns gerne mit einem kleinen Betrag unterstützen möchten, haben Sie die Möglichkeit, dies hier zu tun.